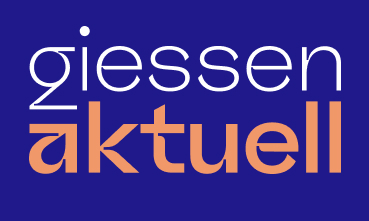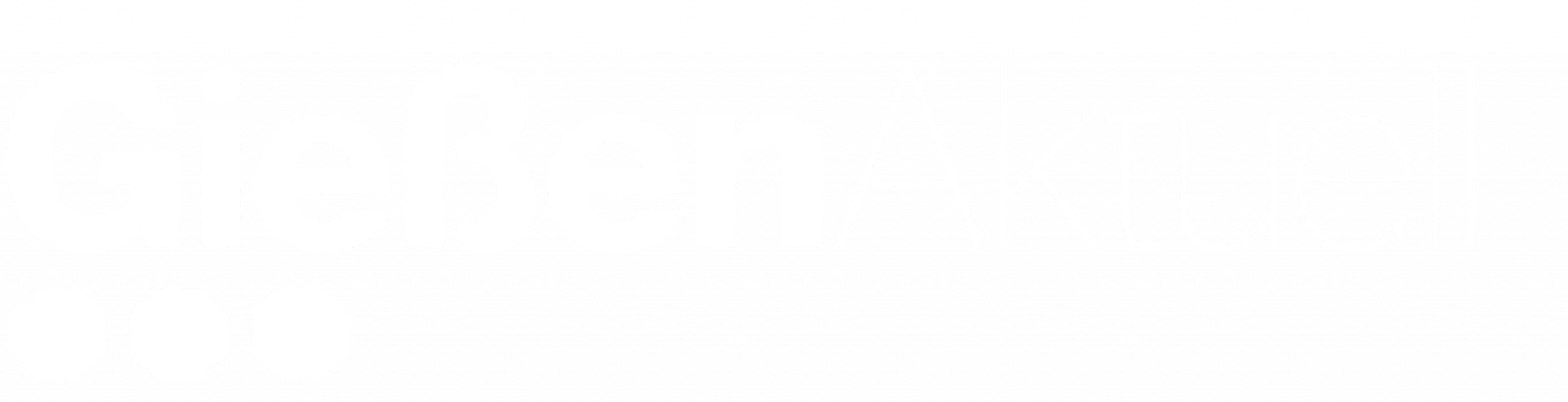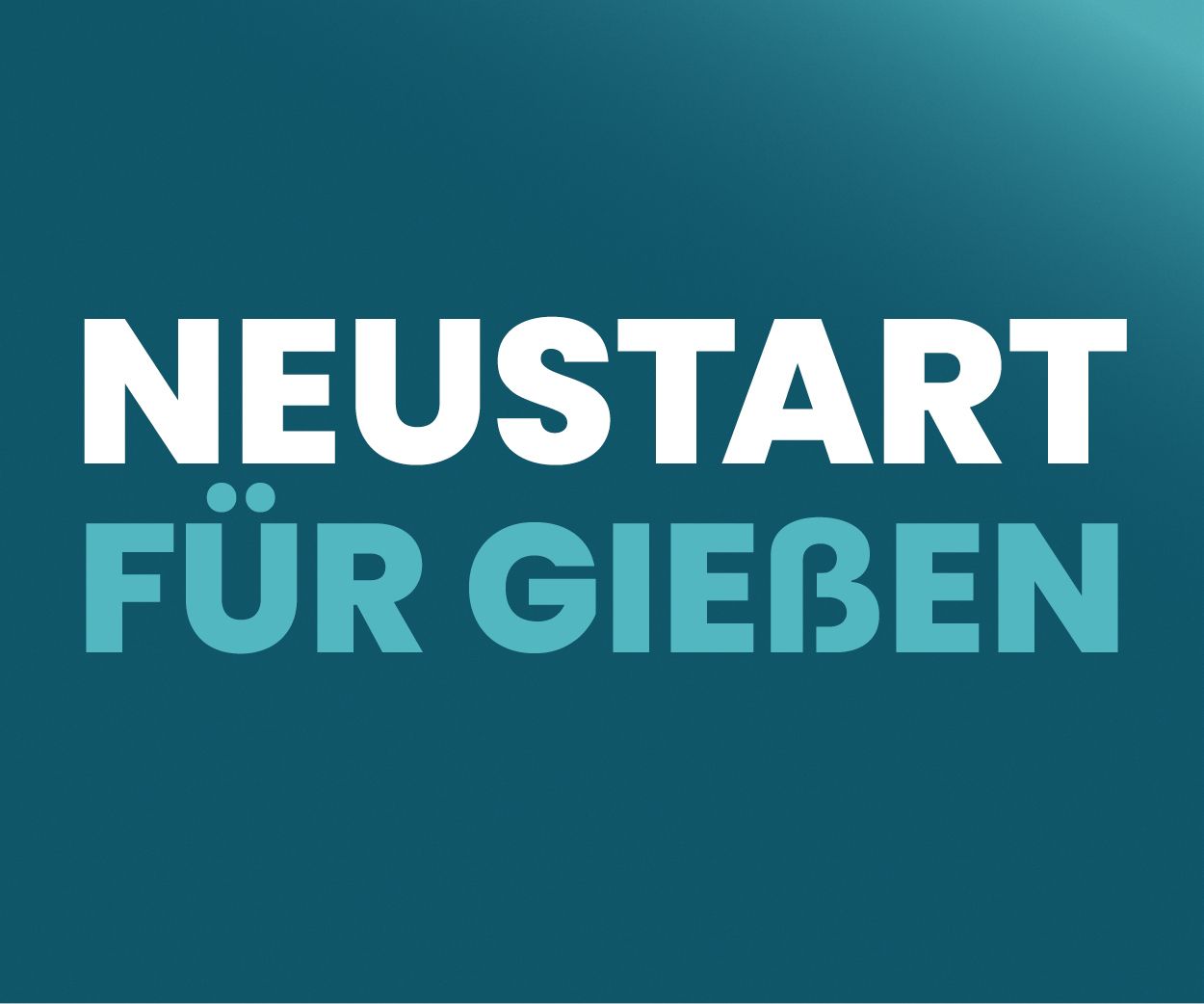GIESSEN (fw). Ein Teilchendetektor namens RUBIK, entwickelt an der Justus-Liebig-Universität Gießen, soll an Bord eines Satelliten ins All geschickt werden, um die kosmische Strahlung in der Nähe der Erde zu untersuchen. Der Detektor besteht aus kubischen Elementen und sieht aus wie ein Zauberwürfel.
Die Mission die im Rahmen der Kleinsatellitenmission ROMEO der Universität Stuttgart durchgeführt werden soll hat das Ziel, neue Technologien und wissenschaftliche Messungen im mittleren Erdorbit zu testen und soll 2025 starten. Wir waren vor Ort und haben uns das Projekt einmal angesehen:
Es sind nur kleine unscheinbare Würfel, die für die Weltraumforschung jedoch von großer Bedeutung sein könnten. Der RUBIK der Justus-Liebig-Universität Gießen. Doch wofür braucht man das?
Das Experiment will Verbindungen zwischen den von RUBIK erfassten kosmischen Teilchen in der Erdumlaufbahn und den Teilchen zeigen, die auf der Erde durch den Kontakt der kosmischen Teilchen mit der Atmosphäre entstehen: „Wenn kleine Energieteilchen auf die Atmosphäre treffen, werden diese zerstreut und Regnen in einem Teilchensturm nieder. Mithilfe unseres Teilchendetektors möchten wir in Verbindung mit Messinstrumenten die auf der Erde verteilt sind, dieses Phänomen genauer untersuchen, da dieser Vorgang bisher schlecht erforscht ist“, erzählt Dr. Hand-Georg Zaunick vom Physikalischen Institut der JLU. Unter den Teilchen seien auch solche, die eine so hohe Energiedichte ausweisen, wie sie auf der Erde auch künstlich nicht erzeugt werden könne.

Und so gehts: Die Teilchen treffen in die Lichtdurchlässigen Würfel, die das gebrochene Licht mithilfe von Lichtwellenleitern weitergeben und in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale können dann ausgewertet und analysiert werden. Wenn das Experiment erfolgreich ist, werden die Forscher im besten Fall neue Informationen über die Entstehung und Entwicklung dieser Teilchenstürme erhalten. Die Ergebnisse von RUBIK werden auch in internationalen Datenbanken verfügbar gemacht, die dann für die Vorhersage und Entwicklung neuer Modelle zum Weltraumwetter von Bedeutung sein werden. Der Satellit ist insgesamt 60 Kg schwer und soll dann im Jahr 2025 in den Erdorbit geschossen werden.